Internationale Bildung
Immer mehr Arbeitnehmer benötigen interkulturelle Kompetenzen und immer mehr Unternehmen sind auf der Suche nach gut ausgebildeten internationalen Fachkräften.

International gut ausgebildete Fachkräfte sind eine der wichtigsten Ressourcen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und einer sinkenden Erwerbsbevölkerung werden ausländische Fachkräfte für Deutschland immer wichtiger. Ein Ziel im Handlungsfeld Internationale Bildung ist es, dass sich deutsche Studierende sicher im internationalen Umfeld bewegen, zum Beispiel durch einen Auslandsaufenthalt im Studium oder ein internationalisiertes Studium zu Hause. Der Anteil von deutschen Absolventen mit Erasmus-Erfahrung soll deshalb bis 2020 auf 10 Prozent ansteigen, wie es bereits in den besten EU-Ländern im Jahr 2010 der Fall war. Gleichzeitig soll Deutschland ein attraktiver Studienort für ausländische Studierende sein: Ein Fünftel der Studierenden im ersten Hochschulsemester soll 2020 aus dem Ausland kommen. Um diese Ziele zu erreichen, müssen deutsche Hochschulen schon heute durch englischsprachige oder internationale Studiengänge und die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt problemlos in den Studienverlauf zu integrieren, die strukturellen Voraussetzungen schaffen.
- Internationale Bildung erneut stärkstes Handlungsfeld
- Zielmarke für 2015 von 50 Punkten wird nur knapp verfehlt
- Deutsches Hochschulsystem immer attraktiver für ausländische Studierende und Wissenschaftler
- Deutscher Arbeitsmarkt profitiert nicht ausreichend von ausländischen Studierenden
- Zu wenig Studierende gehen ins Ausland
Der Index für das Handlungsfeld Internationale Bildung legt im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu und steigt von 33 auf 44 Punkte. Die internationale Bildung bleibt somit das Handlungsfeld mit dem höchsten Indexwert und der stärksten Steigerung. Dennoch verfehlt sie damit zur Halbzeitbilanz die Zielmarke von 50 Punkten knapp. Um das für 2020 gesteckte Ziel zu erreichen, müsste sich der Index in den kommenden Jahren weiter um etwa 11 Punkte jährlich erhöhen. Diese Erhöhung entspricht der Dynamik der vergangenen beiden Jahre und ist somit durchaus realistisch.
Zahl der Studierenden mit ausländischen Wurzeln auf Rekordhoch
Deutsche Hochschulen werden für ausländische Studierende immer attraktiver. Die Zahl der Studienanfänger mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung und ausländischem Pass – sogenannte Bildungsausländer – hat sich seit 2010 rasant entwickelt. 2010 waren rund 66.400 Bildungsausländer an deutschen Hochschulen eingeschrieben, 2015 liegt die Zahl mit rund 99.000 Studierenden knapp 50 Prozent darüber. Das für 2020 gesetzte Ziel von 87.000 Studierenden ist somit bereits deutlich übererfüllt und der Indikator liegt bei 100 Punkten. Gemessen an allen Studienanfängern liegt der Anteil der Bildungsausländer bei 19,6 Prozent. Entsprechend kommt fast jeder fünfte Studienanfänger aus dem Ausland. Auch laut dem aktuellen Study.EU Country Ranking ist Deutschland für internationale Studierende mit Blick auf Bildung, Lebenshaltungskosten sowie Karriereaussichten das attraktivste Studienland Europas.
Die Gründe für den deutlichen Zuwachs an ausländischen Studierenden in den vergangenen Jahren liegen einerseits in den gesteigerten Marketingaktivitäten deutscher Hochschulen im Ausland, die die Attraktivität des Studienstandorts Deutschland herausstellen. Initiativen wie GATE-Germany, ein gemeinsames Konsortium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), oder die Kampagne Study-in.de sind dabei zentral. Andererseits haben auch wirtschaftliche und politische Entwicklungen, wie internationale Wirtschaftskrisen oder die massiven Erhöhungen der Studiengebühren in einigen angloamerikanischen Systemen, den Zustrom ausländischer Studierender begünstigt. Aktuelle Entwicklungen wie der geplante Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU oder die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten lassen vermuten, dass die Attraktivität Deutschlands als Studienort für ausländische Studierende in den kommenden Jahren noch weiter zunehmen könnte.
Zahlenmäßig niedriger fallen hingegen die internationalen Absolventenzahlen aus. Aktuell sind 36.370 Studienabsolventen Bildungsausländer. Obwohl sich der Indikator seit 2010 stetig um insgesamt 8.162 Personen erhöht hat, liegt er mit einer Zielerreichung von 29 Punkten deutlich unter der diesjährigen Zielmarke von 50 Punkten. Zudem beträgt der Anteil der Bildungsausländer an allen Absolventen derzeit lediglich 7,6 Prozent. 2010 betrug der Anteil bereits 7,8 Prozent. Entsprechend weist der Indikator eine negative Zielerreichung von -8 Punkten auf.
Die Absolventenzahlen verdeutlichen, dass trotz Bologna-Reform noch zu wenig Bildungsausländer ihr Studium in Deutschland abschließen. Hier gilt es, Maßnahmen zur Reduzierung der Abbruchquoten zu implementieren, die insbesondere auf die Phasen der Auswahl der Studierenden, die Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt sowie die Betreuung während des Studiums abzielen.
Anteil englischsprachiger Studiengänge steigt
Die zunehmende Internationalisierung der Hochschulen spiegelt sich auch im Angebot von englischsprachigen Studiengängen wider. Seit 2010 ist deren Anteil an allen Studiengängen kontinuierlich von 4,4 auf 5,9 Prozent in dem Jahr 2015 gestiegen. Der Indikator liegt mit 65 Punkten also deutlich über der diesjährigen Zielmarke von 50 Punkten.
Personal an Hochschulen wird internationaler
Auch das Personal an deutschen Hochschulen wird internationaler. Während 2010 noch 6 Prozent aller Professoren Ausländer waren, sind es gegenwärtig knapp 6,7 Prozent. Der Indikator liegt mit 46 Punkten knapp unter der Zielmarke von 50 Punkten. Die Dynamik der Steigerung muss also in den kommenden Jahren zunehmen, um das Ziel für 2020 von 7,5 Prozent zu erreichen. Der Anteil der ausländischen wissenschaftlichen Mitarbeiter an allen Mitarbeitern zeigt ein ähnliches Bild. 2010 betrug er 11,8 Prozent. Aktuell hat sich der Indikator auf 13,6 Prozent gesteigert und weist eine Zielerreichung von 47 Punkten auf. Deutsche Hochschulen werden also nicht nur für ausländische Studierende attraktiver, sondern auch für wissenschaftliches Personal aus dem Ausland. Dabei bleibt jedoch anzumerken, dass das internationale wissenschaftliche Personal oftmals aus dem benachbarten deutschsprachigen Ausland kommt (Österreich, Schweiz). Zukünftig wäre es darüber hinaus wünschenswert, ausländisches Personal aus nicht deutschsprachigen Ländern für deutsche Hochschulen zu gewinnen.
Wahrnehmung von Auslandsaufenthalten verlängern das Studium
Deutlich negativer entwickelt sich dagegen das Urteil deutscher Studierender über die Rahmenbedingungen eines Auslandsaufenthalts. In dem Jahr 2010 gaben noch 30,5 Prozent an, dass ein Auslandsaufenthalt ohne eine Verlängerung der Studiendauer möglich ist. Diese Einschätzung teilten 2014 nur noch 20,7 Prozent. In dem Jahr 2015 steigt der Indikator zwar wieder auf 23,5 Prozent, liegt aber immer noch deutlich unter dem Wert von 2010. Damit weist der Indikator eine Zielerreichung von dramatisch schlechten -100 Punkten auf. Die organisatorischen Hürden, einen Auslandsaufenthalt innerhalb des Regelstudiums zu absolvieren, erscheinen also immer noch recht hoch.
Die gemeinsamen Internationalisierungsbemühungen von Bund, Ländern, Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in den vergangenen Jahren haben deutliche Früchte getragen. Seit Beginn der Erhebungen des Hochschul-Bildungs-Reports ist dieses Handlungsfeld durchgehend am stärksten; die für 2015 avisierte Zielmarke von 50 Punkten wird annähernd erreicht. Besonders erfreulich ist die positive Entwicklung der Studienanfängerzahlen bei ausländischen Studierenden. Diese Entwicklung geht auch maßgeblich auf die Leistungen und den Erfolg des internationalen Hochschulmarketings, zum Beispiel der Kampagne Study-in-Germany zurück. Trotz der großen Erfolge im Bereich der Internationalisierung und der hohen Attraktivität des Studienstandorts Deutschland ergeben sich Herausforderungen, die zukünftig gezielt adressiert werden müssen.
1. Studienabbruch ausländischer Studierender reduzieren
Der Hochschul-Bildungs-Report mahnt zu Recht die zu niedrige Absolventenquote bei ausländischen Studierenden an. Ursächlich hierfür sind die hohen Studienabbruchquoten internationaler Studierender. Nach den neuesten Zahlen betragen diese im Bachelor 41 Prozent und im Masterstudium 28 Prozent und fallen damit deutlich höher aus als bei den deutschen Studierenden. Hier gilt es, durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern:
- Die Gesetzeslage wie auch die Hochschulen selbst müssen bei der Auswahl und Zulassung größeren Wert auf die Studierfähigkeit der Studienbewerber legen.
- Die Studienvorbereitung in Deutschland muss stärker an die spezifische Lage der Bildungsausländer angepasst werden und von geeigneten Vorbereitungskursen im sprachlichen und fachlichen Bereich flankiert werden.
- Vorhandene Maßnahmen zur Integration, Betreuung und Begleitung internationaler Studierender müssen deutlich ausgeweitet werden.
2. "Immobile" deutsche Studierende gezielt für einen Auslandsaufenthalt begeistern
Grundsätzlich sind die Mobilitätsquoten deutscher Studierender im europäischen und internationalen Vergleich als sehr hoch zu bewerten. Dennoch sollte diese Quote durch folgende Maßnahmen verbessert werden:
- Gezielte Ansprache und Unterstützungsleistungen für die Studierendengruppen, die aus unterschiedlichen Gründen eine vergleichsweise niedrige Mobilitätsquote aufweisen (zum Beispiel Lehramtsstudierende, insbesondere im Grundschullehramt; Studierende in MINT-Fächern; Studierende mit Kind; Erstakademiker;
- Studierende mit Beeinträchtigungen)
- Ausbau der zielgruppenspezifischen Marketingmaßnahmen, zum Beispiel der Kampagne des Deutschen Akademischen Austauschdienstes studieren weltweit – ERLEBE ES!
3. Übergreifendes Handlungsfeld: Digitalisierung für die Internationalisierung nutzen
In der Digitalisierung liegt enormes Potenzial für die weitere Internationalisierung der deutschen Hochschulen. Beispielsweise können digitale Lern- und Lehrformate im Kontext der "Internationalisierung zu Hause" eingesetzt werden: So ermöglichen neue Formen der virtuellen Mobilität, wie MOOCs, interkulturelle Lehr- und Lernerfahrungen auch denjenigen Studierenden, die ihre Heimathochschulen nicht verlassen können oder wollen. Um das Potenzial der Digitalisierung für die Internationalisierung auszuschöpfen, bedarf es gezielter Fördermaßnahmen.
Fazit: Die deutschen Hochschulen sind in Sachen Internationalisierung sehr gut aufgestellt. Wir werden uns aber auch weiterhin angesichts des immer härter werdenden weltweiten Wettbewerbs um die besten Köpfe weiterhin anstrengen müssen.
Erstklassig ausgebildete Fachkräfte sind die wichtigste Ressource für den Technologiestandort Deutschland. Ich unterstütze MINTernational, um unsere Hochschulen zum Magnet für internationale Talente zu machen.
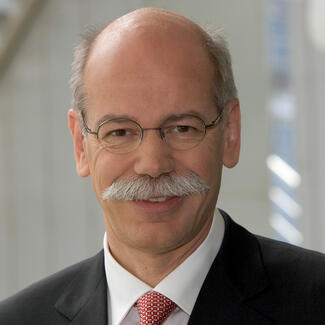
Dieter Zetsche
Vorsitzender des Vorstandes der Daimler AG und Themenbotschafter für das Handlungsfeld Internationale Bildung
Bildungsausländer in den neuen Bundesländern
(Fokus 2016)
Die Anzahl der Bildungsausländer im ersten Hochschulsemester in Deutschland erreicht 2014 ein Rekordhoch.
Campus international
(Fokus 2015)
Die Internationalisierung der deutschen Hochschulen wird vorwiegend unter außenpolitischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet. Im Hochschul-Bildungs-Report 2020 – Jahresbericht 2015 wird eine andere, seltener gewählte Perspektive eingenommen, die Sicht der Wirtschaft auf die Internationalisierung der Hochschulbildung. Die ökonomische Sichtweise soll die anderen Perspektiven sinnvoll ergänzen.
Das Potenzial von Studierenden aus EU-Krisenländern nutzen
(Fokus 2014)
Die ökonomische Krise in einigen europäischen Ländern betrifft in besonderer Weise die Jugendlichen. Das hat auch Auswirkungen auf die Studierendenmobilität nach Deutschland. Die größte Wachstumsrate unter den ausländischen MINT-Studierenden weisen die Angehörigen der EU-Krisenländer auf, besonders aus Griechenland, Spanien und Italien.
Video: Spitzentalente gewinnen

